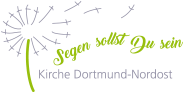Predigt am 3. Sonntag d. Osterzeit
- Menschen, mit denen wir intensiv zusammengelebt haben, in der Familie, Freunde oder Vorbilder, begleiten uns ein Leben lang. Auch wenn sie nicht mehr da sind, setzen wir uns mit ihnen auseinander, prägen sie unser Denken und Tun weiterhin.
Ja, es scheint ja sogar so zu sein, dass wir die Bedeutung von Menschen für uns oft erst im Nachhinein verstehen. Der Dichter Elias Canetti hat das in seiner wunderbaren Autobiographie Die Fackel im Ohr an einer Stelle schön formuliert. Von einer Beziehung zu einem Freund schreibt er: „Ich lernte von ihm, dass man bei einem Menschen sehr lange hinsehen kann, ohne etwas zu wissen und verstehen, dass sich erst viel später entscheidet, ob man etwas von einem Menschen weiß, nämlich erst dann, wenn man ihn aus dem Auge verloren hat“. Für Lebenszeiten gilt das auch. Ich persönlich spüre das zurzeit auf meine vergangenen Jahre in Herne hin. Jetzt, wo ein Abstand entsteht, zeigt sich Manches klarer, kommt ein ‚Nachgeschmack‘, was besonders kostbar war, oder was wehgetan hat.
Dieser Gedanke kann helfen, die Osterberichte in den Evangelien zu verstehen. Keiner von ihnen ist ja aus dem unmittelbaren Eindruck des Ostertages niedergeschrieben worden, sondern zwischen den Ereignissen damals und der Abfassung z.B. des Lukasevangeliums, aus dem wir gerade gehört haben, liegen ca. 50 Jahre, zwei Generationen. Da berichten also nicht Augenzeugen, sondern mündliche Überlieferungen wurden niedergeschrieben. Trotz dieses Abstandes, obwohl die Menschen am Ende des 1. Jh. Jesus nie gesehen hatten, lebten sie intensiv mit ihm. Er prägte ihr Denken und Fühlen. Er war wirklich gegenwärtig, vielleicht mehr als mancher Mensch, den man täglich sieht.
„Dann öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift…. Musste nicht all das geschehen…“, so heute im Evangelium. Eine solche Erkenntnis ist oft erst aus einem Abstand heraus möglich ist. Solange er da war, hieß es immer wieder: „Sie verstanden ihn nicht“. So haben alle Ostergeschichten zwei Ebenen: Auf der einen Seite sind sie eine, über die mündliche Weitergabe vermittelte Erinnerung an das Ostergeschehen. Aber noch viel mehr zeigen sie uns, wie Menschen, die eine starke innere Beziehung zu Jesus Christus haben, verändert werden, was der Osterglaube im Menschen wandeln kann – damals wie heute. Zwei Gedanken dazu – österliche Einsichten, die mich in diesem Jahr besonders nachgehen.
- „Seht meine Hände und Füße an: Ich bin es selbst!“, so gerade im Evangelium. Alle Ostergeschichten stimmen darin überein, dass die Jünger Jesus an den Wunden erkennen. Christlich sozialisiert, haben wir diese Aussage so oft gehört, dass das Gewicht dieser Aussage gar nicht mehr fassen, denn das heißt doch: Die Wunden dieser Welt sind jetzt ein Teil Gottes. Als Christen glauben wir an einen verwundeten, verletzlichen Gott.
So wie wir schon mal bei schwer Erkrankten sagen: ‚Er ist gezeichnet’ oder ‚man sieht, was er durchmachen musste’, so kann man vielleicht sagen: Gott machte das menschliche Leid durch, und das sieht man ihm an.
Die Osterberichte erzählen von Angst und Furcht der Jünger. Die frühen Gemeinden erlebten sich als gesellschaftliche Randgruppe, bedroht, manchmal verfolgt. Was ihnen Lebensfreude und Stärke zurückgab, war der Blick auf die Wunden Christi. Wenn für ihn das Kreuz nicht der Endpunkt war, dann ist das Hoffnung für alle Zeiten und jeden Menschen. „Durch seine Wunden sind wir geheilt“, dieser prägnante Satz aus dem ersten Petrusbrief ist ja nicht eine philosophische Spekulation, sondern konkrete Lebenserfahrung!
Die berührendsten Ostererlebnisse sind für mich mit Menschen, denen es geschenkt worden ist, in einer inneren oder äußeren Not in Gott ihren Anker zu haben; Menschen, durch die ein Urvertrauen spürbar wird, dass alles in unserem Leben und in dieser Welt von IHM umfasst ist.
Ich erinnere mich an Sterbende, die in einem völligen inneren Frieden sind, die mich trösten und aufrichten; an starke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Einrichtung für Menschen im Wachkoma, die es möglich gemacht haben, dass wir mit den Menschen, die dort leben und mit Jugendlichen gemeinsam erst Gottesdienst und dann ein Begegnungsfest feiern konnten; an einen Besuch vor einigen Jahren in Kangemi, einem der großen Slums am Rande von Nairobi. Die Jesuiten machen dort eine wunderbare Arbeit. Obwohl die äußeren Bedingungen für uns unvorstellbar sind, kommt man in eine Gemeinde, in der man Lebendigkeit und Hoffnung spürt. Ich habe selten in meinem Leben eine fröhlichere Sonntagsmesse feiern dürfen. Die Zeit heilt Wunden, sagen wir. SEINE Wunden heilen – uns, heute. Das ist erfahrbare Gegenwart seiner Auferstehung.
- Dennoch… kommt jetzt ein deutliches ‚Aber‘! Und das ist meine zweite österliche Einsicht: Wir können solche Ostererfahrungen nicht ‚machen‘ (im Sinne von ‚herstellen‘). Wir haben Ostern, unseren Glauben überhaupt, nicht ‚immer griffbereit‘. Wir werden davon ‚er-griffen‘. Auch diese Erfahrung zieht sich durch alle Ostergeschichten: „Halte mich nicht fest“ sagt Jesus Maria von Magdala. Die ersten Christen erfuhren Jesus als jemanden, der ‚sich zeigt‘ und ‚sich entzieht‘. Am deutlichsten berichtet dies die Emmausgeschichte. Als er das Brot brach, da heißt es: „Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn; und er entschwand ihren Blicken“. Was bleibt ist: „Brannte nicht unser Herz in uns!“.
Glauben, ein Mensch mit „brennendem Herzen“ zu sein, bedeutet, auf einen sehr persönlichen, lebenslangen Weg der Suche nach Gott geschickt zu sein. Ich gestehe, dass ich das als die für mich als echte Herausforderung erlebe. Denn natürlich erwarte ich durch den Glauben, dass ich mich in den Umbrüchen und Bedrängnissen, die das Leben bereithält, festmachen kann. Natürlich will ich, dass mein Leben glückt, will es „retten“. Doch ER sagt mir: „Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren“ … „Halte mich nicht fest“.
Für die Jünger hörte das „unterwegs-Sein zu Gott“ Ostern nicht auf. Es fing erst richtig an. Lesen Sie mal die Apostelgeschichte. Die alte Erfahrung des Volkes Israel bleibt auch für Christen gültig: Nur nur für die, die unterwegs bleiben, lässt sich Gott finden, nicht für die, die sich festgesetzt haben.
Natürlich: Niemand findet Gott durch Suchen, aber: Nur dem Suchenden offenbart sich Gott! Das ist das eigenartige Paradox des Glaubens. Für unser ganzes Leben gilt der Auftrag, der Ruf: „Bleib nicht länger stehn bei dem Grab, such nicht bei den Toten den, der lebt“. Unser ganzes Leben beginnen wir, uns zu Gott aufzumachen. Und diese österliche Dynamik gilt nicht nur für unseren persönlichen Glauben, sondern auch für uns als Kirche/als Gemeinden. Für unsere Epoche, für die Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft und Kirche, sogar ausgesprochen drängend: Nur im Unterwegs-sein lässt Gott sich finden, nicht für die, die sich festgesetzt haben.
„Gott, öffne mir die Augen, mach weit meinen Blick und mein Interesse, damit ich sehen kann, was ich noch nicht erkenne.
Gott öffne mir die Ohren, mach mich hellhörig und aufmerksam, damit ich hören kann, was ich noch nicht verstehe.
Gott, gib mir ein vertrauensvolles Herz, das sich deinem Wort überlässt und zu tun wagt, was es noch nicht getan hat“ (W. Lambert)
Georg Birwer