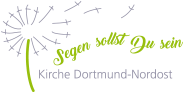„Herr, lehre uns beten – eine eigenartige Bitte. Die Jünger waren doch gesetzestreue Juden, die von Kindheit an Beten gelernt hatten… Wieso fragen die?
Jesus hatte ihnen eine völlig neue Glaubenswelt eröffnet, das öffentliche Beten in langen Gewändern nennt er Heuchelei. Wenn er betet, zieht er sich zurück – in die Nacht, auf einen Berg. Das macht die Jünger neugierig. Wie können sie selbst zu einem persönlichen Zugang zu Gott finden? Eine neue Beziehung zu Gott – eine neue Art des Betens; dafür steht das ‚Vater unser’.
Beten – wie geht das? Schon in der einleitenden Frage der Jünger steckt für mich ein erster Hinweis: Die Jünger kommen auf Jesus zu, nicht er auf sie! Beten kann man nicht „beibringen“ wie die Bedienung eines technischen Gerätes. Jeder, der einmal versucht hat, Menschen, die nicht wissen, was Beten ist oder keinen Zugang dazu haben, Gebet zu erklären, weiß das.
Beten beginnt, wo Menschen Sehnsucht nach dem Gebet haben. „Herr, lehre uns beten“ ist ja nicht die Bitte, ein Gebet zu lernen, eine Formel, die ich spreche; es ist die Suche, der Begegnung mit Gott einen Ausdruck zu geben. Beten ist weniger das, was wir sprechen, sondern dass wir uns in eine Haltung bringen, eine Ruhe, eine Sammlung, dass Er, Gott, zu uns und in uns sprechen kann, dass er in unser Leben eindringen und es verändern kann.
Damit sind wir bei der entscheidenden Frage: Wie kommen wir zu dieser Haltung, dass Gott zu uns und in uns sprechen kann? In diese ‚Schule’ nimmt Jesus seine Jünger. In der Bergpredigt bei Matthäus heißt es: „Wenn Du betest, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu“. Beten geht nur, indem ich mich zurückziehe, innerlich und oft auch äußerlich. Es muss, oft wortwörtlich, Raum geschaffen werden, der hilft, meine Aufmerksamkeit auf die Stimme Gottes in mir zu lenken. All unseren Gebetszeichen, das Stehen, das Falten oder Öffnen der Hände, das Zuhalten der Augen, das Knien, die Kniebeuge …. haben einzig den Sinn, in diese Ausrichtung zu kommen.
Wir sind sinnliche Wesen, mit Leib und Geist, deswegen ist das Beten auch nie nur etwas Geistiges, sondern auch körperlich. Dazu braucht es das Stillwerden, das Staunen, das Hören auf die Stimmen in unserem Leib und in unserem Herzen. Der Hamburger Bischof Heße wurde einmal von Kindern gefragt, wie lange er am Tag betet. Darauf erzählte er ihnen, wie er manchmal einfach dasitzt, vielleicht eine halbe Stunde, wie Gedanken und Gefühle ihn umtreiben, er sich immer wieder ausrichtet – und am Ende steht vielleicht ein einfaches „Hilf, Herr, meines Lebens“ oder „Dank sei Dir“! Wie lange hat er gebetet? Nur wenige Sekunden – könnte man sagen; und doch gehört die halbe Stunde unbedingt dazu.
Die Verschlossenheit der Kammer –ist das äußere Zimmer, aber noch viel mehr ist es die Herzenskammer. Ohne den regelmäßigen Rückzug in diese ‚Kammer’ stirbt unsere Beziehung zu Gott. ‚Rückzug in die Kammer’, das heißt: alle und alles hinter uns zu lassen, für eine feste Zeit am Tag/in der Woche, vielleicht morgens, bevor der Tag beginnt, oder abends, wenn das Laute zur Ruhe kommt
Diese Verschlossenheit der Kammer braucht es auch hier, im Gottesdienst. Natürlich steht beim Gottesdienst das Gemeinsame, die Feier im Mittelpunkt. Aber ein Gottesdienst, der nicht auch Raum lässt für die ganz persönliche, ja intime Begegnung zwischen mir und Gott, wird schnell banal und macht sich überflüssig.
Und schließlich sind da noch die Worte des Gebetes, dass Jesus die Jünger lehrt. Gerade in der Fassung des Lukas, die wir heute gehört haben, hat eine Einfachheit, die fast verstört. Kein Wort zuviel: „Wenn ihr betet, so sprecht: ‚Vater’“. Wenn ihr betet, sagt Papa, wie die Kinder auf der ganzen Welt ihre Väter anreden. Schlichter geht’s nicht! Fast unangenehm. Im Grunde ist es von vorn bis hinten ein Bettelgebet
Das Vater unser ist auch insofern bemerkenswert, weil das Bittgebet in allen Religionen eher verpönt ist. Es ist ein Gebet der ‚kleinen Leute’, die Gott unverblümt sagen, was ihnen auf dem Herzen ist. Unsere Leseordnung unterstreicht das noch dadurch, dass dem Evangelium eine fast verstörende Lesung zur Seite gestellt wird, in der Abraham mit Gott verhandelt wie auf einem orientalischen Basar. Beten kann bedeuten, dass ich meine Not, das, was in mir weint, hinausrufe; mancher Psalm ist eine einzige Klage, wo Menschen Gott zur Rechenschaft ziehen für den Zustand der Welt.
Jesu sagt: „Ich bin gekommen, den Armen die Frohe Botschaft zu bringen“. Von ihnen her denkt und fühlt er. In den einfachen ‚armen‘ Worte des Vater unsers steckt der Anfang einer neuen Beziehung zum Leben und zur Welt. Wir müssen vor Gott nichts aus uns machen. Wir müssen ihm nicht sagen, wer und was wir sind. Und so kann auch unser Gebet immer einfacher werden. Er ist der Abba, das Väterchen. In dieser Einfachheit will er uns begegnen. Ame